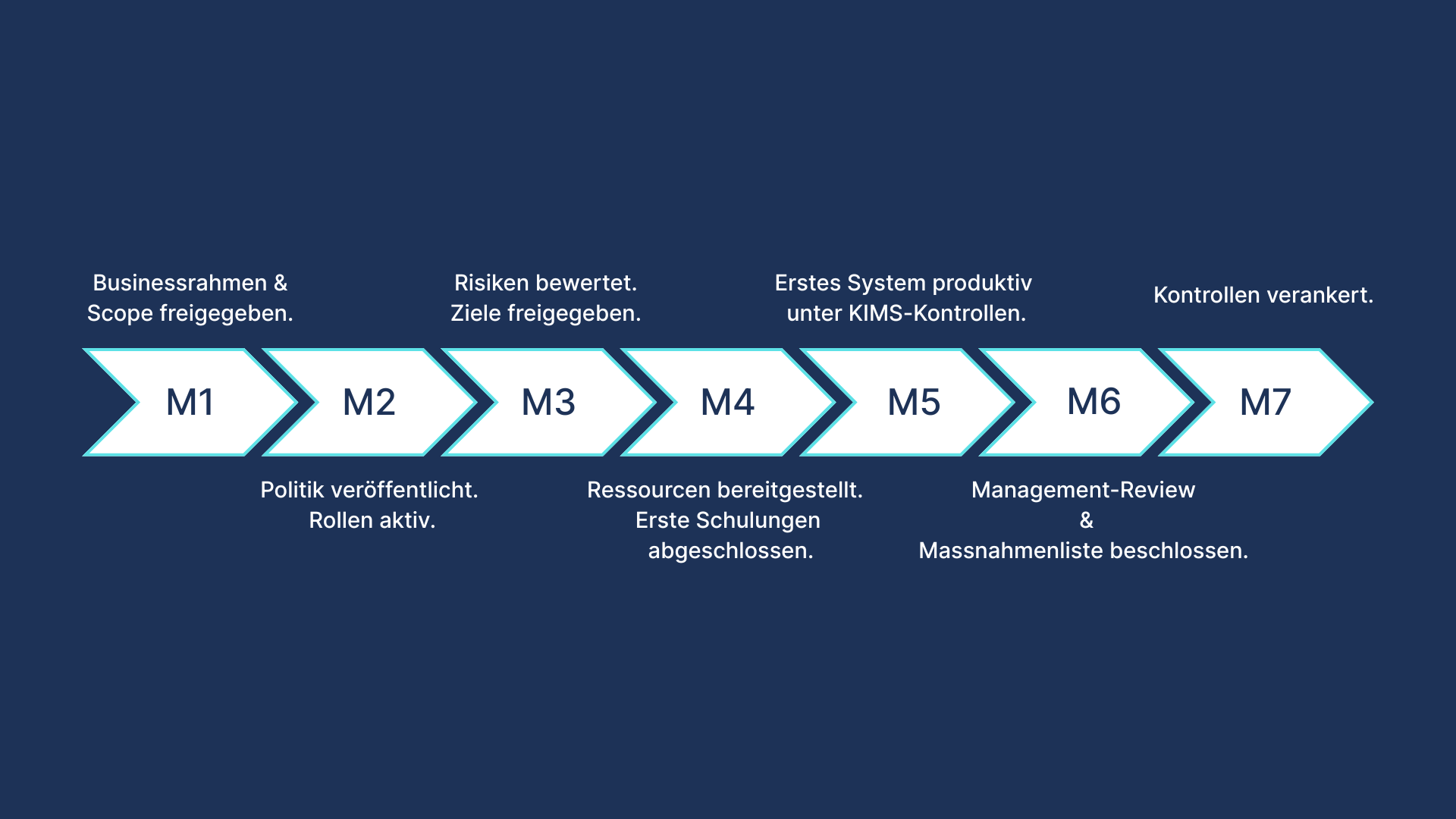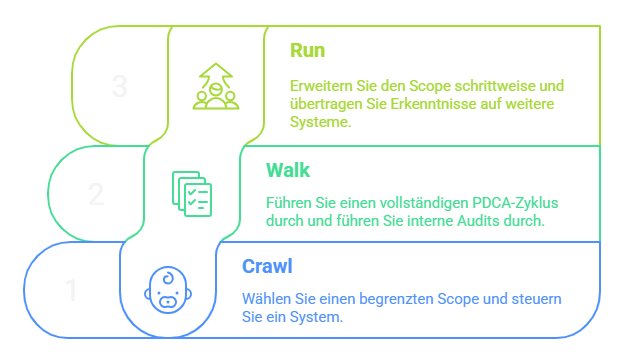ISO/IEC 42001 (AIMS/KIMS) Implementierungsplan: Risiken senken
Künstliche Intelligenz (KI) ist überall. Von den Tools, die wir bei der Arbeit nutzen, bis zu den Apps auf unseren Smartphones prägt KI, wie Unternehmen arbeiten und wie Menschen leben. Mit ihrem wachsenden Einfluss steigt auch der Bedarf, sie verantwortungsvoll einzusetzen. Fragen zu Vertrauen, Ethik, Datenschutz und Rechenschaftspflicht stehen inzwischen im Zentrum der Debatten in Vorstandsetagen und Regierungen.
Die im Dezember 2023 veröffentlichte ISO/IEC 42001:2023 ist der weltweit erste internationale Standard für Managementsysteme für Künstliche Intelligenz (AIMS/KIMS). Er bietet Organisationen eine strukturierte Vorgehensweise, um KI verantwortungsvoll zu entwickeln, einzuführen und zu steuern. Man kann ihn als das ISO 9001 der KI verstehen, nur dass der Fokus nicht auf Qualitätsmanagement liegt, sondern auf dem Aufbau von Vertrauen in Entwicklung und Einsatz von KI.
Warum wurde ISO 42001 entwickelt?
KI eröffnet enorme Chancen, bringt jedoch auch Risiken mit sich. Fehlgebrauch oder unbeabsichtigte Schwächen können zu Verzerrungen, Sicherheitsvorfällen, Reputationsschäden oder Verstößen gegen regulatorische Vorgaben führen. Bislang haben sich Unternehmen auf ein Flickwerk aus Ethikleitlinien und staatlichen Rahmenwerken gestützt, die je nach Land stark variieren.
Entwickelt wurde die ISO 42001 um:
einen globalen Massstab für verantwortungsvolle KI-Nutzung zu setzen
Organisationen beim Management von KI-Risiken zu unterstützen
Transparenz und Rechenschaft in der KI-Entwicklung zu fördern
Vertrauen bei Kundinnen und Kunden, Aufsichtsbehörden und Öffentlichkeit zu stärken
An wen richtet sich der Standard?
Der Standard richtet sich an jede Organisation, die KI entwickelt, nutzt oder auf sie angewiesen ist, egal ob großer Tech-Anbieter mit eigenen KI-Plattformen oder Unternehmen, die KI-gestützte Tools im Tagesgeschäft einsetzen.
Zusammenfassend kann gesagt werden
ISO 42001 ist ein Schritt hin zu menschenzentrierter KI. Der Standard markiert den Wandel vom rein technischen Werkzeug hin zu einer Technologie, die auf tiefgreifende Weise mit dem Leben von Menschen interagiert.
Für Unternehmen geht es nicht um Häkchen auf Compliance-Listen. Es geht darum, verantwortungsvoll zu führen, in einer Welt, in der Vertrauen in Technologie fragil und zugleich unverzichtbar ist. Organisationen, die ISO 42001 anwenden, zeigen Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und der Gesellschaft, dass KI sowohl innovativ als auch verantwortungsvoll sein kann.
Mittelstand braucht einen belastbaren Rahmen für KI, sonst drohen Verzögerungen, Haftungsfragen und Blockaden in Projekten.
KI-Projekte scheitern oft an unklaren Rollen, fehlenden Freigaben und mangelnden Nachweisen. ISO 42001 adressiert das als Managementsystem auf PDCA-Basis und macht KI verlässlich steuerbar: Governance, Risiko, Lebenszyklus und Nachweise.
Schlüsselfaktoren: Nachweisbarkeit, Risikosteuerung, Geschwindigkeit, Compliance-Sicherheit.
Ergebnis: schnellere Freigaben, geringeres Bussgeldrisiko, dokumentierte Qualität, bessere Anbietersteuerung.
Implementierungsplan in 7 Schritten
Implementierungsplan ISO 42001
1. Initialphase: Kontext und Scope
Ziel: geschäftlichen Rahmen und Scope festlegen. Ergebnis: Zielbild, Scope, Messgrößen, RACI. Hinweise: starten Sie schlank mit einem überschaubaren System.
M1: Businessrahmen und Scope freigegeben.
2. Führung: Verantwortung und KI-Politik
Ziel: Top-Management bindet sich verbindlich ein. Ergebnis: KI-Politik mit messbaren Grundsätzen; Mandat; Gremium; KI Managementbeauftragter. Beispiel-Grundsatz: quartalsweise Bias-Prüfung mit Reporting an das Gremium.
M2: Politik veröffentlicht. Rollen aktiv.
3. Planung: Risiken, Ziele, Änderungen
Ziel: Risiken und Chancen bewerten, Ziele koppeln, Änderungen steuern. Ergebnis: Risiko-Register, Behandlungspläne, Zielkatalog, Change-Prozess.
M3: Risiken bewertet. Ziele freigegeben.
4. Unterstützung: Ressourcen, Kompetenzen, Informationen
Ziel: Mittel, Skills, Informationen bereitstellen. Ergebnis: Budget und Tools, rollenbasierte Schulungen, Kommunikations- und Krisenplan, Dokumentenlenkung.
M4: Ressourcen und Plattform. Erste Schulungen abgeschlossen.
5. Betrieb: Sicherer KI-Lebenszyklus
Ziel: KI-Systeme entlang des Lebenszyklus steuern. Ergebnis: Prozesslandkarte, Modellkarten, Datenkatalog, SLAs, Auditlogs, Freigabechecklisten.
M5: Erstes System produktiv unter KIMS-Kontrollen.
6. Leistungsbewertung: Wirksamkeit messen
Ziel: Steuerung über KPIs, Audits und Management-Review. Ergebnis: KPI-Dashboard, Auditplan und -berichte, Managementbewertung. Kennzahlenideen: Vorfälle durch Fehlentscheidungen, Zeit bis Korrektur, Auditfeststellungen, Schulungsquoten, Zielbeiträge.
M6: Management-Review mit Massnahmenliste beschlossen.
7. Verbesserung: Lernen verankern
Ziel: Abweichungen beheben und Standards fortschreiben. Ergebnis: Verbesserungsregister, aktualisierte SOPs, Trainings-Updates. Quelle der Learnings: Projekte, Audits, Vorfälle, Management-Review.
M7: Verbesserungen in Prozessen und Kontrollen verankert.
Checkliste (kurz)
Scope auf ein priorisiertes System begrenzt
KI-Politik verabschiedet und veröffentlicht
Rollen inkl. KI-Managementbeauftragter benannt
Risiko- und Impact-Methodik verbindlich festgelegt
Risiko-Register mit Behandlungsplänen gepflegt
Lebenszyklusprozesse dokumentiert und genutzt
Schulungen rollenbasiert durchgeführt
KPI-Dashboard produktiv, Reporting aktiv
Internes Audit geplant und terminiert
Management-Review mit Maßnahmenliste vereinbart
Vorgehen in drei Stufen
crawl-walk-run
Crawl: Begrenzten, relevanten Scope wählen. Ein System sauber steuern.
Walk: Vollen PDCA-Zyklus durchlaufen.
Run: Scope schrittweise ausweiten. Erkenntnisse auf weitere Systeme übertragen.
Herzlichst
Peter Duliba